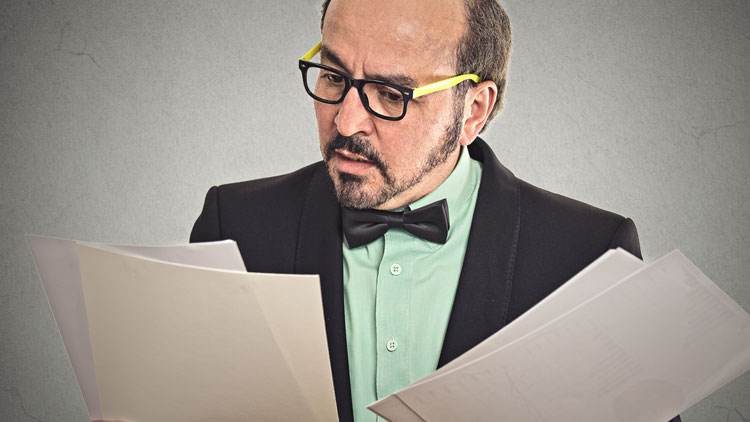Vertrag anfechten: Gründe, Voraussetzungen, Fristen
Von: Verbraucherzentrale Bayern
In diesem Beitrag finden Sie
- Was bedeutet "Anfechtung" eines Vertrages?
- Voraussetzungen für eine Anfechtung
- Anfechtungsgründe
- Fristen für eine Vertragsanfechtung
- Wie erklärt man eine Anfechtung?
- Wann ist eine Anfechtung eines Vertrages ausgeschlossen?
- Welche Wirkung hat die Anfechtung?
Was bedeutet "Anfechtung" eines Vertrages rechtlich?
Die Anfechtung ist eine sogenannte "rechtsvernichtende Einwendung". Das bedeutet: Durch die Anfechtung ist ein wirksam zustande gekommenes Rechtsgeschäft, wie beispielsweise ein Kaufvertrag, von Anfang an als nichtig anzusehen. Das bedeutet, dass der Vertrag so zu behandeln ist, als hätten die Parteien diesen nie abgeschlossen.
Die Anfechtung muss durch eine entsprechende Erklärung gegenüber dem Vertragspartner oder der Vertragspartnerin geltend gemacht werden. Damit ein Vertrag wirksam angefochten werden kann, müssen folgende Voraussetzungen erfüllt sein:
Voraussetzungen und Gründe für eine Anfechtung
Zunächst muss ein Grund für die Anfechtung vorliegen. Auch muss die Anfechtung innerhalb einer bestimmten Frist erklärt werden und es darf kein Ausschlussgrund vorliegen (siehe weiter unten).
Das BGB kennt folgende Anfechtungsgründe, die in den §§ 119, 120 und 123 BGB geregelt sind:
- Irrtumsfälle
- unrichtige Übermittlung
- arglistige Täuschung
- widerrechtliche Drohung
Anfechtung wegen Irrtums
Wann ein Irrtum als berechtigter Grund für eine Anfechtung gilt, ist auch unter Juristinnen und Juristen in vielen Fällen umstritten. Unterschieden werden im Wesentlichen
- der Inhaltsirrtum,
- der Erklärungsirrtum,
- der Motivirrtum und
- der Berechnungs- oder Kalkulationsirrtum.
Der Inhaltsirrtum: Wenn die Erklärung zum Vertrag "unklar" ist
Ein Inhaltsirrtum liegt dann vor, wenn die Person, die einen Vertrag schließen möchte, bewusst und gewollt handelt, ihr aber nicht klar ist, welche Bedeutung ihre Erklärung hat.
Beispiel für einen Inhaltsirrtum: Verbraucher V möchte bei der Autohändlerin U ein Auto kaufen. Er sagt: „Ich möchte das Auto hinten im Hof kaufen". Dabei meint er einen schwarzen Mini. Er sieht dabei nicht, dass im Hof mittlerweile ein schwarzer Opel steht.
Der Erklärungsirrtum: Wenn man sich verschreibt
Ein Erklärungsirrtum liegt vor, wenn sich eine Person verspricht, vergreift oder verschreibt. Das Erklärte entspricht nicht dem Willen des oder der Erklärenden.
Beispiel für einen Erklärungsirrtum: Unternehmerin U will der Verbraucherin V ein schriftliches Angebot für die Reparatur einer antiken Uhr für 530 Euro unterbreiten. U verschreibt sich hierbei und schreibt statt 530 Euro irrtümlich 350 Euro. V nimmt das Angebot an.
Der Motivirrtum: Nur in Ausnahmen anfechtbar
Ein Motivirrtum ist grundsätzlich unbeachtlich und somit auch nicht anfechtbar.
Beispiel für einen unbeachtlichen Motivirrtum: Der Juwelier J bietet der Verbraucherin V einen alten Ring für 50 Euro an. Tatsächlich ist der Ring aber mindestens 500 Euro wert. Hätte J das gewusst, hätte er den Ring nicht an V verkauft bzw. mindestens 500 Euro verlangt.
In Ausnahmsfällen ist auch ein Motivirrtum ein relevanter Grund für die Anfechtung eines Vertrages. Irrt der oder die Erklärende bei der Abgabe einer Willenserklärung über eine "verkehrswesentliche Eigenschaft" der Person oder der Sache, auf die sich das Rechtsgeschäft bezieht, kann er seine Willenserklärung anfechten. Unter dem Begriff verkehrswesentliche Eigenschaften fallen beispielsweise die Herkunft, das Alter und die Beschaffenheit einer Sache, oder die Echtheit bei Kunstwerken. Zu berücksichtigen sind dabei ausschließlich Faktoren, die den Wert bilden, wie zum Beispiel das Material. Der Wert der Sache selbst ist keine zu berücksichtigende Eigenschaft. In Bezug auf das oben genannte Beispiel bedeutet das: Hätte der Juwelier sich nicht einfach nur über den Wert geirrt, sondern zum Beispiel einen Goldring für einen Messingring gehalten und deswegen billiger verkauft, läge ein beachtlicher Eigenschaftsirrtum vor.
Beispiel für einen beachtlichen Eigenschaftsirrtum: Händlerin X verkauft dem Verbraucher V ein Bild. Dieses stammt von einem Künstler namens Y. Neben diesem Y gibt es auch einen sehr berühmten Maler namens Y. V kauft das Bild. X glaubt, dass V weiß, dass es sich bei dem Bild und vor allem bei dem Preis des Bildes nicht um ein Werk des berühmten Malers Y handelt. V weiß dies aber nicht. Er erfährt erst im Nachhinein, dass sein Bild zwar auch von einem Maler namens Y, nicht hingegen vom berühmten Y stammt.
Der Berechnungsirrtum: Rechenfehler im Angebot
Ein Berechnungs- oder Kalkulationsirrtum ist grundsätzlich als unbeachtlicher Motivirrtum einzuordnen und damit nicht anfechtbar. Davon gibt es allerdings ebenfalls Ausnahmen. Eine Anfechtung kommt beispielsweise dann in Betracht, wenn die Kalkulation dem Vertragspartner bzw. der Vertragspartnerin bekannt und auch Gegenstand der Vertragsverhandlungen war.
Beispiel: Der Handwerker H unterbreitet der Verbraucherin V ein schriftliches Angebot für das Streichen von Fenstern. Pro Fenster veranschlagt er einen Pauschalpreis von 25 Euro. Insgesamt sind 21 Fenster von außen neu zu streichen. Er errechnet einen Gesamtpreis von 300 Euro, anstatt des richtigen Ergebnisses von 525 Euro. Hier ist H berechtigt seine Erklärung anzufechten. Es liegt ein Kalkulationsirrtum vor. Der Rechenfehler zeigt sich schon im Angebot deutlich. Anders wäre der Fall zu beurteilen, wenn H seine Kalkulationsgrundlage nicht offengelegt hätte. Hätte er seine Malerarbeiten pauschal für 300 Euro angeboten, weil er sich selber beim Ausrechnen vertippt hat (statt 25 mal 21 hat er 25 mal 12 gerechnet), so läge ein unbeachtlicher Motivirrtum vor. Dieser würde H nicht zur Anfechtung berechtigen.
Die anfechtende Person muss beweisen, dass ein Irrtumsgrund vorliegt, der zur Anfechtung berechtigt und dass sie die Erklärung ansonsten nicht abgegeben hätte.
Anfechtung wegen falscher Übermittlung
Ein Fall der unrichtigen Übermittlung liegt vor, wenn man sich zur Übermittlung einer Willenserklärung zum Beispiel eines Botendienstes bedient. Dabei übermittelt der Bote die Willenserklärung unbewusst falsch. Der oder die Erklärende kann diese dann anfechten, sofern er oder sie die Willenserklärung so nie abgegeben hätte.
Beispiel: Verbraucherin A beauftragt ihren Sohn S, 100 Bücher zu bestellen. S bestellt aber 1000 Bücher. A kann hier wegen falscher Übermittlung anfechten.
Die anfechtende Person muss auch hier wieder beweisen, dass ein Anfechtungsgrund vorliegt.
Anfechtung wegen arglistiger Täuschung
Für die Praxis von Bedeutung ist auch die Anfechtung wegen arglistiger Täuschung. Oft handelt es sich bei einer solchen Täuschung auch um Betrugsdelikte. Das Verhalten kann dann auch strafrechtlich relevant sein. Eine arglistige Täuschung setzt voraus, dass die Täuschung zum Zweck der Erregung oder Aufrechterhaltung eines Irrtums erfolgte. Das arglistige Verhalten muss vorsätzlich sein. Der oder die Handelnde muss die Unrichtigkeit seiner bzw. ihrer Angaben kennen oder für möglich halten.
Beweisen muss die Arglist allerdings die Person, die die Anfechtung erklären möchte. Dies bereitet in der Praxis häufig Schwierigkeiten.
Beispiel: Gebrauchtwagenhändlerin U verkauft ein Fahrzeug an den Verbraucher V als unfallfrei. Anlässlich einer umfangreichen Wartungsarbeit stellt sich nach dem Kauf heraus, dass das Fahrzeug erhebliche Vorschäden durch Unfälle aufweist. Dies war U bekannt.
Vertragsanfechtung wegen widerrechtlicher Drohung
In der Praxis kommt eine Anfechtung wegen widerrechtlicher Drohung eher selten vor. Unter einer Drohung ist zu verstehen, dass einer Person ein künftiges Übel in Aussicht gestellt wird. Dabei muss die Drohung die anfechtende Person in eine Zwangslage versetzen. Ein künftiges Übel kann hier jeder Nachteil sein.
Beispiel: X droht Y mit Schlägen, falls diese nicht das stark beschädigte und sehr alte Motorrad von X kauft. Y willigt in den Kaufvertrag ein.
Auch hier gilt: Wer wegen einer widerrechtlichen Drohung einen Vertrag anfechten möchte, muss beweisen, dass er oder sie bedroht wurde
Fristen für eine Vertragsanfechtung
Die Anfechtung hat bei Irrtümern und wenn sie falsch übermittelt wurde unverzüglich zu erfolgen, also direkt nachdem der Anfechtungsberechtigte den Grund für die Anfechtung erfahren hat. Geregelt ist dies in § 121 BGB. Bei einer Anfechtung wegen arglistiger Täuschung oder widerrechtlichen Drohung muss die anfechtende Person die Anfechtung innerhalb eines Jahres erklären. Im Falle der arglistigen Täuschung beginnt diese Frist mit dem Zeitpunkt, zu dem die anfechtende Person Kenntnis von der Täuschung erlangt hat und im Fall der widerrechtlichen Drohung zu dem Zeitpunkt, zu dem die Zwangslage aufgehört hat.
Wie erklärt man eine Anfechtung?
Die Anfechtung muss gegenüber der Vertragspartnerin oder dem Vertragspartner erklärt werden. Auf das Wort Anfechtung kommt es dabei nicht an. Es genügt, wenn sich aus der Erklärung ergibt, dass die anfechtende Person nicht mehr an ihre ursprüngliche Erklärung gebunden sein möchte.
Wann ist eine Anfechtung ausgeschlossen?
Die Anfechtung darf nicht ausgeschlossen sein. Dies wäre höchstens dann der Fall, wenn das anfechtbare Geschäft von der anfechtenden Person bestätigt worden ist.
Welche Wirkung hat die Anfechtung?
Durch die Anfechtung gilt das abgeschlossene Geschäft rückwirkend als nie zustande gekommen. Die anfechtende Person muss jedoch bedenken, dass bei einer wirksamen Anfechtung die Anfechtungsgegnerin oder der Anfechtungsgegner möglicherweise einen Schadensersatzspruch geltend machen kann. Die anfechtende Person ist dann verpflichtet, den Schaden zu ersetzen, der der Vertragspartnerin oder dem Vertragspartner dadurch entstanden ist, dass sie oder er auf den geschlossenen Vertrag vertraut hat.
Der Freistaat Bayern stellt Ihnen auf dieser Website unabhängige, wissenschaftsbasierte Informationen zum Verbraucherschutz zur Verfügung.
Einzelfallbezogene Rechtsauskünfte und persönliche Beratung können wir leider nicht anbieten. Auch dürfen wir Firmen, die sich wettbewerbswidrig verhalten, nicht selbst abmahnen.
Sollten noch Fragen zu Ihrem konkreten Sachverhalt verbleiben, wenden Sie sich bitte an die unter Service genannten Anlaufstellen.